Über den Autor
Michael Reicherts lebt in Fribourg/Schweiz und in Berlin. Nach zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen als Professor der Psychologie schreibt er seit einigen Jahren Erzählungen und Kurzromane unter verschiedenen Pseudonymen. Seine Literatur ist wie ein Labor, in dem emotionale und soziale Extremsituationen untersucht werden, wo versuchsweise Antworten erprobt und in eine sprachliche Gestalt übersetzt werden. Für ihn ist Literatur auch eine Fortsetzung psychologischer Erkundung mit anderen Mitteln. Seine Bücher werden verlegt von Königshausen & Neumann.

Bisher erschienen:


Fotos der Lesung in Antiquariat und Buchhandlung "Morgenstern", Berlin, 26.8.2022
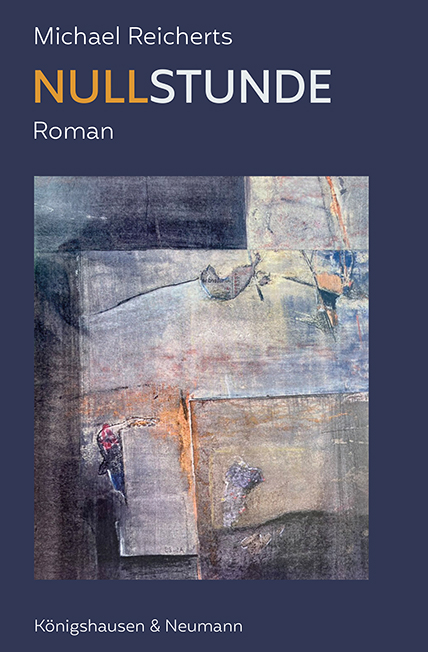
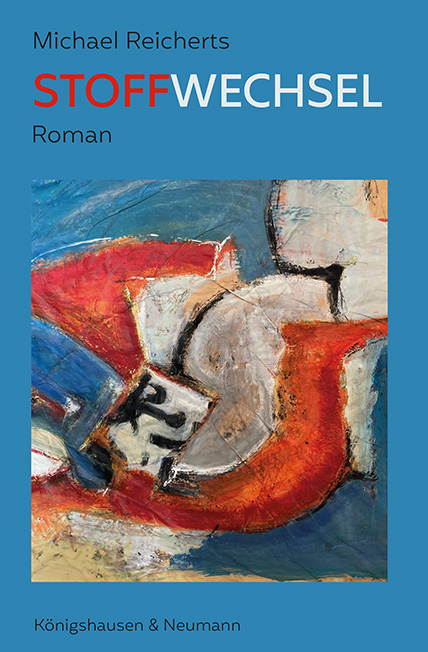
![Liebe[n] & Tod[e] – Erzählband Buchcover](images/Lieben-und-Tode-Cover.jpg)